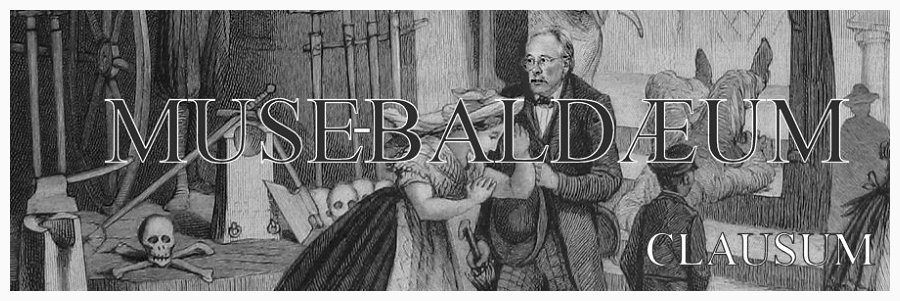Fürst Moritz, Sir Henry Tate, Cornelis van Joost und Max sitzen im Palast vor dem Mädchen mit dem Perlenohrgehänge im Haag zusammen.
Johann Moritz von Nassau-Siegen, "der Brasilianer" genannt, Sohn des Grafen Johann VII. von Nassau-Dillenburg und der Prinzessin Margaretha von Holstein-Sonderburg-Plön, Feldmarschall, General-Gouverneur der Besitzungen der Niederländisch-Westindien-Kompanie in Brasilien, dessen Motto ist: Qua patet orbis (Soweit der Erdkreis reicht) erobert an der afrikanischen Goldküste das portugiesische Fort El Mina, Zentrum eines Sklavenmarktes, baut in Brasilien die Zuckerindustrie durch Sklavenhandel und
-arbeit wieder auf.
Mit den ungeheuren Gewinnspannen aus dem Sklavenhandel - es war billiger, die Sklaven neu zu kaufen, anstatt sie richtig zu ernähren (wodurch viele verhungerten) - finanziert der Fürst sein nach ihm benanntes Palais, das Jacob van Campen, renommiertester niederländischer Architekt, entwirft.
Sir Henry Tate, Pfarrerssohn aus Lancashire, Lebenmittelhändler, Partner der Zuckerraffinerie John Wright & Co, die er später komplett kontrolliert und in Henry Tate & Sons umbenennt, kauft ein Zuckerwürfelpatent, wird dadurch schnell Millionär und Sammler zeitgenössischer Kunst, die er der Regierung vermacht unter der Bedingung, eine Galerie anstelle des alten Millbank-Gefängnisses zu errichten, wofür er
£ 80.000 spendet.
£ 80.000 spendet.
Cornleis de Jong, studierter Landwirt aus Holland, aufgewachsen in der Nähe von Surabaya auf einer Zuckerplantage, baut Zuckerrüben bei Deventerden an; ihn hat Max im Crown Hotel in Southwold kennengelenrt.
Ob sich Sir Henry Tate und Fürst Moritz bei der Frage einig werden, ob die Zuckerherstellung nicht ohne Sklaven zu machen war, ist unbekannt (jedenfalls aber gab es vor Johann Moritzens Aufenthalt in Brasilien so gut wie keinen Sklavenhandel, zwischen 1636 und 1645 aber brachten die Holländer insgesamt mehr als 23.000 afrikanische Sklaven dorthin).
Und unser Max - unsichtbar - erzählt:
Bis zur Sperrstunde unterhielten wir uns an diesem Abend in der Bar noch über den Auf- und Niedergang der beiden Nationen sowie über die eigenartig engen Beziehungen, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein zwischen der Geschichte des Zuckers und der Geschichte der Kunst bestanden, weil die enormen Gewinne, die bei dem in der Hand weniger Familien liegenden Zuckerrohranbau und Zuckerhandel anfielen, lange Zeit hindurch, aufgrund der begrenzten anderweitigen Möglichkeiten einer sinnfälligen Demonstration des angehäuften Reichtums, zu einem beträchtlichen Teil verwendet wurden für die Errichtung, Ausstaffierung und Unterhaltung prachtvoller Landsitze und Stadtpaläste. Es war Cornelis de Jong, der mich hinwies darauf, daß viele bedeutende Museen wie das Mauritshuis im Haag oder die Londoner Tate Gallery auf Stiftungen von Zuckerdynastien zurückgehen oder sonst irgendwie mit dem Zuckergeschäft verbunden sind. Das im 18. und 19. Jahrhundert durch verschiedene Formen der Sklavenwirtschaft akkumulierte Kapital, sagte de Jong, läuft nach wie vor um, trägt Zins um Zinseszins, vermehrt und vervielfacht sich und treibt aus eigener Kraft andauernd neue Blüten. Eines der probatesten Mittel zur Legitimierung solchen Geldes ist von jeher die Förderung der Kunst, der Ankauf und das Zurschaustellen von Kunstgegenständen und, wie heute zu beobachten ist, das immer weiter fortschreitende, beinahe schon lachhafte Höhertreiben der Preise auf den großen Auktionen, sagte de Jong. Die Hundertmillionengrenze für einen halben Quadratmeter bemalter Leinwand wird in wenigen Jahren überschritten sein. Manchmal, sagte de Jong, kommt es mir vor, als wären sämtliche Kunstwerke von einer Zuckerlasur überzogen oder überhaupt ganz aus Zucker, so wie das von einem Wiener Hofzuckerbäcker gefertigte Modell der Schlacht von Esztergom, das die Kaiserin Maria Theresia in einem furchtbaren Schwermutsanfall angeblich aufgegessen hat mit Stumpf und Stiel.
Und unser Max - unsichtbar - erzählt:
Bis zur Sperrstunde unterhielten wir uns an diesem Abend in der Bar noch über den Auf- und Niedergang der beiden Nationen sowie über die eigenartig engen Beziehungen, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein zwischen der Geschichte des Zuckers und der Geschichte der Kunst bestanden, weil die enormen Gewinne, die bei dem in der Hand weniger Familien liegenden Zuckerrohranbau und Zuckerhandel anfielen, lange Zeit hindurch, aufgrund der begrenzten anderweitigen Möglichkeiten einer sinnfälligen Demonstration des angehäuften Reichtums, zu einem beträchtlichen Teil verwendet wurden für die Errichtung, Ausstaffierung und Unterhaltung prachtvoller Landsitze und Stadtpaläste. Es war Cornelis de Jong, der mich hinwies darauf, daß viele bedeutende Museen wie das Mauritshuis im Haag oder die Londoner Tate Gallery auf Stiftungen von Zuckerdynastien zurückgehen oder sonst irgendwie mit dem Zuckergeschäft verbunden sind. Das im 18. und 19. Jahrhundert durch verschiedene Formen der Sklavenwirtschaft akkumulierte Kapital, sagte de Jong, läuft nach wie vor um, trägt Zins um Zinseszins, vermehrt und vervielfacht sich und treibt aus eigener Kraft andauernd neue Blüten. Eines der probatesten Mittel zur Legitimierung solchen Geldes ist von jeher die Förderung der Kunst, der Ankauf und das Zurschaustellen von Kunstgegenständen und, wie heute zu beobachten ist, das immer weiter fortschreitende, beinahe schon lachhafte Höhertreiben der Preise auf den großen Auktionen, sagte de Jong. Die Hundertmillionengrenze für einen halben Quadratmeter bemalter Leinwand wird in wenigen Jahren überschritten sein. Manchmal, sagte de Jong, kommt es mir vor, als wären sämtliche Kunstwerke von einer Zuckerlasur überzogen oder überhaupt ganz aus Zucker, so wie das von einem Wiener Hofzuckerbäcker gefertigte Modell der Schlacht von Esztergom, das die Kaiserin Maria Theresia in einem furchtbaren Schwermutsanfall angeblich aufgegessen hat mit Stumpf und Stiel.